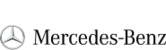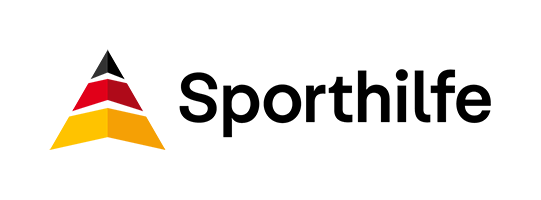
Ex-Handballprofi Cornelius Maas: „Viele Athleten leben in der Honigfalle des Spitzensports“
Cornelius Maas war 2011 U21-Weltmeister, Juniorsportler des Jahres mit der Mannschaft und gehörte zu den größten Talenten im deutschen Handball. Trotz der prognostizierten Karriere beschäftigte sich der ehemals Sporthilfe-geförderte Athlet mit der Zeit nach dem Spitzensport – etwas, das viele Profisportler seiner Meinung nach vernachlässigen. Nachdem der inzwischen 28-Jährige seine Karriere verletzungsbedingt beenden musste, profitiert er heute von seinem frühzeitigen Blick auf die Karriere nach der Karriere.
Cornelius, wie ist das Gefühl, wenn sich langsam aber sicher die Gewissheit einstellt, dass die eigene Leistungssportkarriere zu Ende geht?
Das war sehr schwierig. Als Nachwuchssportler fußt ja deine ganze Identität auf dem Sport. Du lebst jahrelang wie in einer Art Blase, wirst in die eine Rolle hineingedrängt: Bei deinen Freunden oder in der Schule bist du immer nur „der Handballer“ oder „der Sportler“. Eine schwere Verletzung zieht dir dann natürlich den Boden unter den Füßen weg. In meinem Fall kam das Karriereende zwar nicht von heute auf morgen, aber ich wusste schon: Wenn die Schulter, das wichtigste Arbeitsgerät eines Handballers, kaputt ist, ist das relativ schlecht.
Dabei galtst Du einst als großes Talent im deutschen Handball. 2011 warst Du U21-Weltmeister, Dir wurde eine Karriere im DHB-Team prognostiziert. 2012 liefst Du zweimal für die deutsche B-Nationalmannschaft auf, danach aber war Schluss. Was ist schiefgelaufen?
Maßgeblich war die Verletzung nach der Junioren-WM. Auch als die Schulter entzündet war, habe ich damals unter Schmerzmitteln direkt weitergespielt, es war schließlich meine erste Erstliga-Saison, der Druck war hoch. Im vierten Saisonspiel zog ich mir dann eine Schultereckgelenksprengung zu, die leider bleibende Schäden hinterlassen hat. Damit war klar, dass es für eine Karriere in der ersten Liga nicht mehr reichen wird. Mit fast zehn Jahren Abstand sehe ich das entspannt. Es hat eben nicht für die Weltklasse gereicht.
Beruflich gesehen denke ich sogar, dass die Verletzung das Beste war, was mir passieren konnte.

Einige aus der „Klasse von 2011“ schafften es in die A-Nationalmannschaft, etwa Hendrik Pekeler, Johannes Sellin, Christian Dissinger und jüngst auch Patrick Zieker. Was passiert mit denen, die nicht groß rausgekommen sind?
Generell ist ja das Problem: Nach so einem Erfolg wie dem WM-Titel nährst du dich von der Hoffnung, dass es klappen könnte mit der großen Karriere. Diese Hoffnung überstrahlt den Realitätssinn. Hinzu kommt dann schnell eine gewisse Gemütlichkeit abseits der Halle und des Trainings. In der ersten Liga kann man sehr gut von dem Sport leben, selbst in der zweiten Liga bekommen die meisten noch ein gutes Lehrergehalt. Mit 35 kommt dann „plötzlich“ das Karriereende und viele werden von der Realität eingeholt: Was mache ich jetzt die nächsten 30 Jahre? So viele Jobs für Trainer, TV-Experten etc. kann es gar nicht geben. Ich nenne das die „Honigfalle“ des Spitzensports.

Was bedeutet das konkret?
Als Handballprofi sieht dein Alltag in etwa so aus: Zweimal am Tag Training, ein hohes Ansehen, verhältnismäßig viel Freizeit bei attraktivem Verdienst und damit kein Grund, sich wirklich um sein Studium oder seine Weiterbildung zu kümmern. Nachmittags ist die Anziehungskraft der Couch meist größer als die Sorge um die Zeit nach der aktiven Karriere. Ich glaube, da wird einfach Vieles verdrängt. Im aktuellen Moment, quasi in dein Leben reingezoomt, ist alles super. Nur wenn man rauszoomt, 20 Jahre später betrachtet – da fragt man sich vielleicht, ob man diese oder jene Klausur nicht doch besser mitgeschrieben hätte.
Hier sind meines Erachtens vor allem viele junge, angehende Spitzensportler gefährdet und sollten deswegen mehr für die langfristige Sicht sensibilisiert werden.
Dabei befinden sich Handballer noch in einer Luxussituation: In vielen anderen Sportarten reicht der Verdienst eines Spitzensportlers nicht einmal für die Miete.
Es geht hierbei nicht nur ums Geld. Ich glaube, dass viele unterschätzen, wie wichtig der berufliche bzw. ein geregelter Alltag nach der sportlichen Karriere ist. Selbst die wenigen, die in Ihrer Sportart so herausragen, dass sie es schaffen, für die Zeit nach Ihrer sportlichen Karriere finanziell ausgesorgt zu haben, müssen doch Ihren Tag für die nächsten 30 Jahre irgendwie füllen – ganz unabhängig vom Geld.
Was braucht es, um eine Duale Karriere wirklich zu leben?
Es ist brutal fordernd. Man braucht eine ungeheure Selbstdisziplin, um Inhalte neben den täglichen Trainingseinheiten vor- und nachzubereiten. Und man muss dranbleiben, auch nach einer Pause den Faden wiederaufnehmen können. Für mich und sicher auch für viele andere hieß das zum Beispiel, meine Hausarbeiten für die Uni standardmäßig abends nach dem Training, z.B. von 22 Uhr bis in die Nacht zu schreiben.
Du hast kürzlich neben Deinem Beruf in Wirtschaftswissenschaften promoviert, arbeitest heute als Venture Capital Manager. Was machst Du da konkret?
In etwa ist das wie bei „Die Höhle der Löwen“ (lacht). Wir verwalten als Firma Gelder von institutionellen Investoren, die Kapital in innovative Start-ups investieren wollen, vor allem im Gesundheitsbereich.
Nun ist dieser Job konkret oder auch das Studium an sich nicht für jeden das richtige. Was können andere Athleten machen?
Das klassische Modell von früher, bei dem ein Spieler seine Ausbildung auf der Geschäftsstelle seines Clubs macht, gibt es heute nicht mehr. Für Vereine ist es aber vielleicht eine Möglichkeit, die Kontakte in die Wirtschaftswelt zu nutzen und Sportler bei Sponsoren unterzubringen, sei es als feste Mitarbeiter oder zunächst als Praktikanten. Anders ist es natürlich bei Individualsportlern:
Hier finde ich es klasse, wie die Deutsche Sporthilfe Athleten unterstützt, mit Praktikumsstellen oder über Weiterbildungsangebote.
Wenn der Jobeinstieg gelingt, bin ich sicher: Kein Spitzensportler muss einen Beweis dafür erbringen, dass er sich Disziplin und Leistungsfähigkeit in den Lebenslauf geschrieben hat.

(Veröffentlicht am 20.02.2020)
Mehr zu Sprungbrett Zukunft