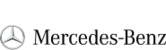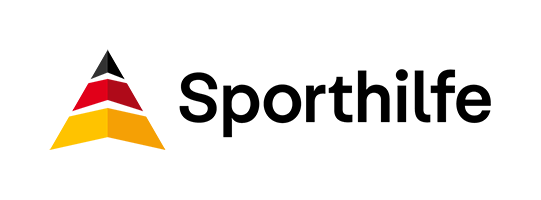
Die drei Leben des Uli Roth: Handball, PUR und Krebsvorsorge
Uli Roth war lange Zeit Handball-Rekordnationalspieler und gewann mit der Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles die Silbermedaille. Nach der sportlichen Karriere wurde er Manager der Band PUR, heute gilt seine Berufung nach eigener schwerer Erkrankung der Krebsvorsorge. Im Sporthilfe-Interview spricht der 56-jährige über seine drei Leben, über Führungsrollen in Sport und Beruf und - natürlich - über Handball.
Uli Roth, in Deutschland gibt es etwas mehr als hundert Hallen mit einer Kapazität von mehr als 1000 Plätzen. In wie vielen davon sind Sie schon gewesen?
Ich bin seit 40 Jahren als Handballer und Musikmanager in deutschen Hallen unterwegs – insofern dürften mir so ziemlich alle bekannt sein. In den letzten Jahren arbeitete ich mit Künstlern zusammen, die das Privileg hatten, in großen Arenen spielen zu können. Daher weiß ich auch: Die Ansprüche der Zuschauer an ihren Besuch haben sich verändert – und das gilt sowohl bei Handballspielen als auch bei Konzerten.
Sie spielen auf die Band PUR an, deren Manager Sie über zwei Jahrzehnte waren. Wie wird man vom Handballnationalspieler zum Musikmanager?
Das war mehr oder weniger Zufall. Die Band habe ich Mitte der 1990er Jahre in einer Hotelbar kennengelernt, kurz nach ihrem Hit „Abenteuerland“. PUR war damals auf dem Höhepunkt, die Band-Mitglieder haben aber immer noch alles selbstgemacht – die Vermarktung, das Booking, das Merchandise. Ich war damals Marketingleiter bei Radio Regenbogen und gestaltete 1996 als Quereinsteiger die große Open-Air-Tour mit. Mit dem Höhepunkt in Düsseldorf, wo PUR vor über 60.000 Menschen spielten. 1997 machte ich mich dann selbstständig und wurde offiziell Band-Manager.
Diese Rolle behielten Sie bis Ende 2017. Weshalb sind Sie und Band-Leader Hartmut Engler auseinandergegangen?
Beim Verhältnis zwischen Band und Manager ist es wie in jeder privaten oder geschäftlichen Beziehung: Manchmal ändern sich die Ansichten und man passt einfach nicht mehr so gut zueinander wie früher. Wir haben es aber geschafft, uns im Guten zu trennen.
Sehen Sie Parallelen zwischen der Arbeit im Musikbusiness und dem Leben als Leistungssportler?
Das ist durchaus vergleichbar. Der Manager ist der Trainer der Band, also der „Mannschaft“. Die Probe kann man als Spielvorbereitung sehen, nur findet sie bei Künstlern in der Garderobe statt und bei uns Sportlern in der Kabine. Das Konzert schließlich ist das Spiel. Teamspirit und Motivation braucht es in beiden Branchen – auch wenn Künstler mehr Freiraum benötigen, um ihre Kreativität auszuleben. Ich musste zwar lernen, zugunsten der Kreativität der Jungs etwas loszulassen, habe der Band aber durchaus auch ein bisschen Disziplin vermittelt.

Teamspirit und Motivation braucht es in beiden Branchen – auch wenn Künstler mehr Freiraum benötigen, um ihre Kreativität auszuleben.
Diese Leader-Rolle hatten Sie schon früher inne, waren Klassen- und Schulsprecher, später Führungsspieler in Ihren Vereinen. Auch die deutsche Nationalmannschaft führten Sie als Kapitän aufs Feld.
Ich liebe es einfach, zu organisieren – und bin dabei wegen meines hohen Anspruchs durchaus kritisch. Auch das kommt aus dem Sport, so wie ich generell alles in meinem Leben dem Sport zu verdanken habe. Ohne ihn wäre ich – als damals wahrscheinlich schlechtester Schüler Süddeutschlands – nie aus meinem Dorf herausgekommen. Meine Eltern haben darauf gedrängt, dass ich neben dem Handball eine Ausbildung mache, wovon ich später natürlich enorm profitiert habe. Insofern war der Sport für mich ein Sprungbrett in mehrere Richtungen.

Sie arbeiten heute auch als Sportmanager, haben Athleten aus unterschiedlichen Sportarten unter Vertrag. Vermitteln Sie denen auch ein Bewusstsein für die Notwendigkeit einer Dualen Karriere?
Absolut. Zu meiner Zeit gab es noch nicht so viele Möglichkeiten zur Weiterbildung, da hat die Sporthilfe ganze Arbeit geleistet und viele tolle Angebote wie etwa das Elite-Forum geschaffen. Meine Agentur verfolgt zwei Schwerpunkte: Neben der Betreuung und Vermarktung der aktiven Sportler eben auch, die Zeit nach der Karriere im Blick zu haben, zu wissen, was danach kommt. Diesen Prozess muss man früh genug einleiten. Das ist mindestens so wichtig wie das Management während der sportlichen Laufbahn.
Wir sprachen über den Sport als Sprungbrett: Sie haben es von Leutershausen bei Heidelberg bis nach Los Angeles geschafft, wo Sie 1984 Olympia-Silber gewannen. Was trauen Sie denn Ihren Nachfolgern bei der WM 2019 in Deutschland und Dänemark zu?
Die kritische Aufarbeitung nach der enttäuschenden EM ist abgeschlossen und nach den klaren Gesprächen gibt es nun keine Dissonanzen mehr zwischen Trainer und Team. Ich denke, alle Seiten haben aus ihren Fehlern gelernt. Wenn die Mannschaft gut in das Turnier hineinfindet, schnell in ihren Rhythmus kommt, dann wird sie auch vom Heimpublikum getragen. Dann ist das Halbfinale drin und das wäre schon ein Erfolg. Ziel muss sein, um die Medaillen mitspielen zu können. Unter den letzten Vier ist die Leistungsdichte dann so hoch, dass es oft auf Glück ankommt. Kurz: Alles ist drin, aber das wissen natürlich auch die anderen.
Wie finden Sie eigentlich den Spitznamen „Bad Boys“, den sich die Mannschaft vor einigen Jahren selbst verpasst hat? Man hört ja immer wieder, er hätte durchaus auch schon zu Ihren Zeiten gepasst …
… sicher, der hätte bei uns auch gepasst – wenn nicht ein noch schlimmerer (lacht). Generell finde ich es schwierig, einen Spitznamen als Marke zu etablieren – ich hätte davon abgeraten. Bei dem Team, aus dessen Mitte „Bad Boys“ kam, mag es gestimmt haben. Aber eine Mannschaft ändert sich ständig und damit auch ihr Charakter. Mit einer Marke verpasst man dem Team von vornherein einen Stempel, der einem im Misserfolg um die Ohren gehauen werden kann. Die Fußballnationalmannschaft kann davon ja ein Lied singen.
Sie scheinen ja noch gut im Handball drin zu stecken. Anders als Ihr Zwillingsbruder Michael, der 1984 ebenfalls bei Olympia dabei war, sind Sie nach der aktiven Laufbahn aber kein Trainer geworden. Wieso eigentlich nicht?
Weil ich schon während meiner Karriere festgestellt habe, dass es auch noch andere interessante und wichtige Aufgaben im Leben gibt. Der Handball war nach der Sportlerlaufbahn meine Rückversicherung, aber nicht meine Berufung. Ich wollte mir selbst beweisen, dass es auch anders geht – das hat geklappt und darauf bin ich ein Stück weit stolz. Außerdem war es mir immer wichtig, mich unabhängig äußern und meine Meinung sagen zu können, auch über den Handball. Das geht nicht, wenn man noch zu stark mit dem Sport verbandelt ist.
Was Sie aber heute mit Ihrem Bruder gemeinsam haben, ist die Rolle als Botschafter für die Krebsvorsorge. 2009 sind Sie beide innerhalb kurzer Zeit an Prostatakrebs erkrankt. Wie hat das Ihr Leben beeinflusst?
Es war natürlich ein Schock. Als mein Bruder die Diagnose bekam, hat das unsere Leben verändert. Drei Monate später hatte auch ich die Gewissheit, an Krebs erkrankt zu sein, behielt dieses Wissen aber vorerst für mich, um andere zu schonen. Das würde ich heute niemals wieder so machen. Gewissermaßen haben wir in dieser Drucksituation aber auch von unseren Erfahrungen aus dem Leistungssport profitiert. Auf die Strapazen der OP haben wir uns sogar mit einer Art „Trainingslager“ vorbereitet. Das half bei der Regeneration.
Bis heute haben Sie sich der Gesundheitsaufklärung verschrieben. Mit welchem Antrieb?
Die Präventionsarbeit ist ohne Zweifel eine der wichtigsten Aufgaben meines Lebens geworden. Für Frauen ist es vollkommen normal, ab einem gewissen Alter zum Frauenarzt zu gehen. Es gibt aber keinen Männerarzt. Und während es heute ein großes Bewusstsein für Brustkrebs gibt, war und ist Prostatakrebs immer noch ein Tabuthema. Auch deshalb haben wir damals unsere relative Bekanntheit genutzt, um ein Buch zu schreiben und mit unserer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Im nächsten Jahr jährt sich das nun zum zehnten Mal. Ein guter Anlass, um noch einmal auf die Dringlichkeit hinzuweisen.
(veröffentlicht am 27.12.2018)

Weitere Alumni-Mitglieder